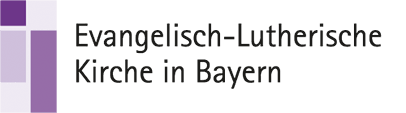Die Gottesfrage als Herz des theologischen Studiums
Mehr Dogmatik!

Der Artikel erläutert, warum die Frage, was wir als Christen heute zu sagen haben, im theologischen Studium eindringlicher denn je gestellt werden sollte
Bild: ELKB
Das Wort Dogmatik löst üblicherweise keine Begeisterungsstürme aus. Es erzeugt eher Abwehrreflexe. Dogmatik – das klingt nach Verknöcherung, nach Intoleranz, nach Zwang und nach Ewiggestrigkeit, vor allem aber nach Bunkermentalität. Wenn im Studium der Theologie, der Religionspädagogik, der kirchlichen Bildungsarbeit und der Diakonik gegenwärtig etwas nicht gebraucht zu werden scheint, dann Dogmatik. Die Devise kann also offenbar nur lauten: Weniger statt mehr Dogmatik! Ich aber plädiere für das Gegenteil.
Und zwar aus Gründen evangelischer Geistesgegenwart. Der Zustand der Kirche, der Welt und der Theologie schreit geradezu nach mehr statt nach weniger Dogmatik. Er schreit nach Kenntlichkeit, nach starken Identifikationen und nach engagierten, sprach- und argumentationsfähigen evangelischen Positionierungen. Er schreit nach klugen, entschiedenen und diskursbereiten Antworten auf die Frage, um die sich in der Dogmatik alles dreht und auf die jede dogmatische Denkbemühung letztlich zielt. Sie lautet: »Was haben wir als Christen heute zu sagen?« Mit anderen Worten:
»Was soll der Inhalt der christlichen Verkündigung sein?«
ROADMAP UND NAVIGATIONSHILFE
Durch das Studium der Dogmatik werden Studierende in die Lage versetzt, diese Frage zu beantworten. Sie verschaffen sich einen Überblick über die Roadmap der Theologiegeschichte. Sie erhalten Navigationshilfen zur Orientierung im Antwortdschungel Abertausender theologischer Veröffentlichungen. Sie nähern sich an das an, was andere vor ihnen gedacht und geglaubt haben und welche Antworten sie auf die Frage gefunden haben, was eigentlich das Geheimnis und die Quintessenz des christlichen Glaubens ausmacht. Idealerweise hilft diese Annäherung Studierenden dabei, eigene christliche Antworten für ihre eigene Gegenwart und deren Herausforderungen zu finden.
GROSSES PRIVILEG
Ich selbst empfinde es übrigens als großes Privileg, hauptberuflich darüber nachdenken zu dürfen, was die Welt im Innersten und Äußersten zusammenhält, wer Jesus Christus heute für uns ist und wie eine Kirche aussieht, die den Namen ihres Herrn verdient oder verspielt. Dass ich als Hochschullehrer tagaus, tagein mit jungen Menschen über Gott und die Welt diskutieren darf, ist eigentlich ein Geschenk des Himmels oder vielmehr meiner Kirche. Dass diese Kirche Kritik nicht nur toleriert, sondern von einem Dogmatikprofessor ausdrücklich erwartet, als institutionalisierte Selbstkritik kirchlichen Redens und Handelns zu fungieren, ist ein bemerkenswert starkes Stück.
SELBSTSÄKULARISIERUNG UND SYSTEMIRRELEVANZ
Derzeit liegt mir in dem Fach, das ich lehre, vor allem eines am Herzen: Ich möchte die Systemrelevanz der Theologie für das akademische Studium und für die evangelische Kirche ins Bewusstsein rücken. Oder anders gesagt: Ich möchte gegen die gegenwärtige Systemirrelevanz der Theologie andenken. Wenn ich Theologie sage, dann meine ich Theologie. Ich nehme das Wort Theologie beim Wort. Theologie bedeutet von jeher reden, nachdenken und nachforschen über Gott. Nicht selten frage ich mich, ob in der Theologie eigentlich noch über Gott nachgedacht wird. Wer mich kennt, weiß, dass diese Frage geradezu mein Mantra, fast schon eine Art Tick ist. Angesichts des Zustands der theologischen Wissenschaft und angesichts des Zustands der Kirche beschleicht mich manchmal der Eindruck, Kirche und Theologie seien insgeheim Proben aufs Exempel, ob es nicht auch ohne Gott und ob es ohne Gott vielleicht sogar besser geht als mit Gott. Mir scheint, als sei der vom Philosophen Friedrich Nietzsche vor fast anderthalb Jahrhunderten verkündete Tod Gottes nicht nur zum Grundgefühl einer transzendental obdachlosen säkularen Welt, sondern auch zum normativen Fundament der heutigen Theologie, vielleicht sogar mancher Ausprägungen von Kirche geworden.
VERTRAUENS- UND IDENTITÄTSKRISE
Wenn das so wäre, dann wäre das verheerend. Denn dann würde sich zeigen, dass Kirche und Theologie sich nicht zuletzt deshalb in einer Relevanz-, Vertrauens- und Identitätskrise befinden, weil sie sich seit Jahrzehnten durch Selbstsäkularisierung selbst gefährden und zur Unkenntlichkeit verstümmeln, um zu überleben. Indem sie ihre Gottesvergessenheit durch Verstärkung moralischer, politischer oder lebensweisheitlicher Kommunikation kompensieren, verschärfen sie die Misere, der sie zu entrinnen suchen. Indem sie den immer selbstverständlicher werdenden gesellschaftlichen Atheismus internalisieren und Theologie in Anthropologie und Dogmatik in Ethik übersetzen, kürzen sich Theologie und Kirche programmatisch oder unwillkürlich aus den Gleichungen des modernen Lebens heraus. Indem sie der Welt den andersweltlichen Gott schuldig bleiben, werden sie in dieser Welt unweigerlich gegenstandslos.
DOGMATIKGESÄTTIGTE ETHIK UND PROTESTANTISCHER PROTESTTHEISMUS
Wenn diese Diagnose stimmt, dann braucht es im theologischen, diakonischen und religionspädagogischen Studium nicht noch mehr Ethikseminare, die die künftigen Arbeiterinnen und Arbeiter im Weinberg des Herrn fit für das moralisch und politisch korrekte Handeln machen. Es braucht vielmehr eine dogmatikgesättigte Ethik, die den Sinn für die Grenzen des Menschenmöglichen, für das Tragische, für das Abgründige und für die Erlösungsbedürftigkeit der menschlichen Natur, sprich: für die Sünde des Menschen, nicht verloren hat. Schöpfungstheologie und Schöpfungsethik sind aktueller denn je. Aber sie dürfen nicht blau- oder grünäugig in Naturverehrung und Naturschutzromantik eingedampft werden. Vielmehr müssen sie die Frage nach dem Bösen, nach der Allmacht Gottes, nach menschengemäßen Möglichkeiten der Chaosbekämpfung und nach dem Verhältnis von Schöpferglaube und Naturwissenschaft angesichts der Herausforderungen unserer Zeit neu stellen.
SOTERIOLOGIE UND HÄRESIOLOGIE
Mehr Dogmatik braucht es in der evangelischen Theologie der Gegenwart auch deshalb, weil es Aufgabe einer zeitgeistkritischen Theologie ist, protesttheistisch an die Lebendigkeit und Wirkmächtigkeit Gottes zu erinnern. Man könnte auch sagen, dass es mehr als fünfhundert Jahre nach der Reformation mehr reformatorische Theologie, also mehr Lehrveranstaltungen über reformatorische Identität braucht. Die Reformatoren hatten inmitten der spirituellen und intellektuellen Sprachlosigkeit des rettungslos maroden spätmittelalterlichen Katholizismus den göttlichen Heiland als Retter in Erinnerung gerufen, Theologie also konsequent als Soteriologie durchbuchstabiert – und zwar so, dass weder der rettende Mensch noch die rettende Kirche noch die rettende Gesellschaft, sondern der rettende Christus ins Zentrum der Theologie gestellt wurde.
DRINGLICHER DENN JE
Die Aktualität der reformatorischen Soteriologie ist also größer denn je – zumal angesichts der Rettungsrhetoriken einer Epoche, deren implizites soteriologisches Axiom im Kielwasser Dorothee Sölles lautet: »Christus hat keine anderen Hände als unsere Hände.« Aus altkirchlicher und reformatorischer Sicht ist diese Soteriologie der großen humanistischen Transformation aller Lebensverhältnisse zutiefst häretisch. Sie ist arianisch, pelagianisch und schwärmerisch. Diese Beobachtung legt den Verdacht nahe, dass gegenwärtig nahezu alle patristischen und reformatorischen Häresien fröhliche Urstände feiern, ja aus sozialethischer Perspektive geradezu als Inbegriff von Rechtgläubigkeit gelten. Wenn das stimmt, dann muss das Phänomen der Irrlehre neu ins Zentrum der dogmatischen Lehre rücken. Die dogmatische Reflexion darüber, welche Formen des christlichen Glaubens den christlichen Glauben von innen heraus zu zerstören drohen und welche Formen des christlichen Glaubens den christlichen Glauben im Geist Christi neu beleben, ist um der christlichen Identität der christlichen Theologie willen vielleicht dringlicher und brisanter denn je. Als Häresiologie qualifiziert Dogmatik in diesem Sinne zur ideologiekritischen Unterscheidung der Geister. Sie sensibilisiert für problemerzeugende Lösungen und für Irrwege. Sie schärft die evangelische Orientierung in einer Zeit, in der jedes Mittel den Zweck des Überlebens von Kirche und Theologie zu heiligen scheint.
FROMM UND FUNDAMENTAL
All das klingt sehr fromm, für viele vermutlich sogar hoffnungslos fundamentalistisch. Dabei ist es nur fundamental. Nicht von ungefähr ist Fundamentaltheologie ein anderer, vielleicht sogar schönerer, in jedem Fall aber höchst sinnvoller Name für Dogmatik. Denn wenn die Dogmatik nicht für jede Gegenwart von Neuem die Fundamente des christlichen Glaubens freilegt, droht sie zur Totengräberin und zur Nachlassverwalterin einer vergangenen Theologie zu werden. Man müsste dann wie weiland Friedrich Nietzsche fragen, was denn theologische Fakultäten und Kirchen noch sind, wenn sie nicht die Grabmäler Gottes sind.
SPIRITUELLE ECHOKAMMERN
Dass eine Dogmatik, die immer neu nach dem Grund des christlichen Glaubens fragt, aufgrund ihres fundamentalen Gottesbezugs als fromm gilt, liegt ebenfalls in der Natur der Sache. Was sonst, wenn nicht fromm, ist jemand, der als Dogmatiker den Glauben zur Sprache bringt? Natürlich könnte es sein, dass manche Dogmatikerinnen und Dogmatiker gar nicht wollen, dass der Glaube in der Dogmatik in der ersten Person Singular, also im Modus der Artikulation anfechtbarer Überzeugungen zur Sprache gebracht wird – vielleicht auch deshalb, weil sie glauben, dass der persönliche Glaube in einem wissenschaftlichen Studium nichts zu suchen hat. Wer so denkt, könnte Dogmatik auf Kulturwissenschaft, auf Religionswissenschaft, auf Religionspsychologie oder auf eine Moderationstechnik des interreligiösen Dialogs reduzieren, was um des Überlebens der Theologie an den staatlichen Universitäten nach dem erwartbaren Ende der Staats-Kirchen-Verträge ja leider längst geschieht. Aber ein solches Verständnis von Dogmatik führt über kurz oder lang zu jenem Relativismus, der in ethischen Debatten nach spätestens drei Minuten aufbricht, wenn der Satz fällt: »Das muss jeder für sich selbst entscheiden.« Will heißen: Niemand hat sich in die religiösen Angelegenheiten anderer einzumischen. Am besten, man tritt keinem in seiner persönlichen spirituellen Echokammer zu nahe. Während die Sozialethik nicht selten zur Übergriffigkeit neigt, neigt die Dogmatik gelegentlich allzu liberal und allzu defensiv dazu, Religion zur Privatsache zu erklären und als theologische Akteurin gar nicht mehr kenntlich zu werden. Ohne entschiedene Positionierungen wären Glaube und Dogmatik allerdings tot. Der Glaube bedarf einer engagierten Subjektivität, die sich in die Nachfolge dessen zu stellen wagt, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Andernfalls wird er beliebig und belanglos und macht er letztlich keinen Unterschied.
TRAININGSLAGER UND LABORATORIUM IM ZWEISTROMLAND
Das Studium der Dogmatik muss also eine Art Trainingslager der Einübung in persönliche, argumentativ fundierte, sprach- und diskursfähige Verkörperungen des Glaubens sein. Es muss zur intellektuellen und spirituellen Auseinandersetzung mit den Positionierungen anderer, also mit den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern der Vergangenheit und der Gegenwart ermuntern. Es muss Züge eines Laboratoriums christlicher Urteils- und Identitätsbildung tragen.
Im Fluss der gegenwärtigen evangelischen Dogmatik gibt es zwei Strömungen, deren eine womöglich mächtiger ist als die andere. Die eine der beiden Strömungen ist von der Überzeugung gespeist, dass der Himmel nicht leer und dass die Menschen nicht mit sich und ihrer moralischen oder psychischen Kraft allein sind, sondern dass Gott ein lebendiger Akteur ist, der sich kraft seiner Allmacht und seiner Freiheit zum menschlichen Glauben, Denken und Handeln verhalten kann. Die andere, reißendere Strömung ist gespeist von der Überzeugung, dass der Mensch die Antwort auf alle Fragen ist, dass Gott allenfalls eine Metapher für eine bestimmte Art von Daseinsbewältigung darstellt, dass es also in der Theologie allenfalls um die Begegnung mit unterschiedlichen Coping-Strategien und Weisheiten zur Bewältigung des individuellen und kollektiven Lebens und zur Linderung der transzendentalen Obdachlosigkeit des Menschen unter einem leeren Himmel geht.
GOTT UND FRAU NEUBAUER
Der Schluss der Kanzelrede, die die Umweltaktivistin Luisa Neubauer in der Passionszeit des Jahres 2021 im Berliner Dom hielt, ist für mich jedes Mal, wenn ich die Schwelle zum Hörsaal oder zum Seminarraum überschreite, Mahnung. »Gott wird uns nicht retten«, sagte Frau Neubauer seinerzeit unter großem Applaus vieler evangelischer Christen. Wenn das wahr ist, sind die Dogmatik und der christliche Glaube obsolet. Wenn das wahr ist, könnten Professorinnen und Professoren der Dogmatik auf der Schwelle der Hörsäle und Seminarräume kehrtmachen. Keine Dogmatikvorlesung wäre dann der Rede und der Mühe wert. Das glaube ich. Natürlich kann ich mich irren. Weil das aber nicht ausgemacht ist, sondern ausgefochten werden muss, braucht es in Hörsälen und Seminarräumen nicht Gesinnungskorridoraufenthaltsanweisungen, sondern den Streit um die Wahrheit und eine Kultur der Achtsamkeit für das bessere, sachgemäßere, christusgemäßere und geistesgegenwärtigere Argument.
Prof. Dr. Ralf Frisch lehrt Dogmatik und Ethik an der Evangelischen Hochschule Nürnberg.